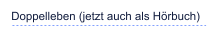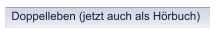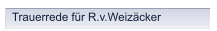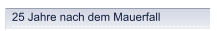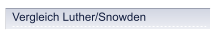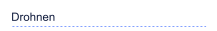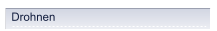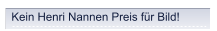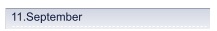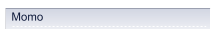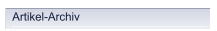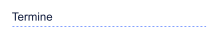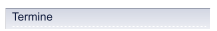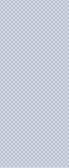
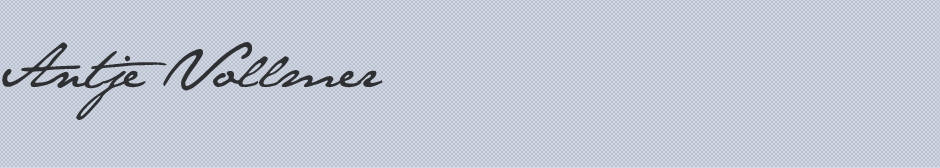





Berlin West
Der aufhaltsame Absturz Westberlins
I. Es soll der Westwind gewesen sein. So lautet zumeist die Begründung dafür, daß in fast allen Metropolen Europas die alles in allem schöneren Viertel der Stadt im Westen liegen. Im Osten waren - jedenfalls in der Zeit, als diese Städte im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert gigantisch wuchsen, - die Fabriken mit ihrem Rauch und Ruß und die sie umgebenden immer enger und ungesunder werdenden Wohnquartiere der Arbeiter und des unaufhörlichen Zuzugs aus Osteuropa. Wer seinen eigenen sozialen Aufstieg unterstreichen wollte, wer es sich leisten konnte, der wohnte im Westen, in den Villengegenden mit den großen Parks und Gartengrundstücken. Das war in Berlin nicht anders. Das explodierende Berlin der Gründerjahre hatte zwar mehrere Zentren und seit dem 18. Jahrhundert seinen Schwerpunkt in der Gegend um den Gendarmenmarkt und die "Linden". Aber spätestens seit dem Zusammenschluss zu Großberlin 1929 war das moderne und mondäne Berlin in Charlottenburg, am Lietzensee, im Grunewald. Hier trafen sich die politischen Köpfe der Stadt, die nobelsten Teile des jüdischen Bürgertums, die Intellektuellen und Künstler. Nicht nur, weil die Luft so gut, die Parks so hinreißend und die Seegrundstücke so geeignet waren für gesellschaftliche Treffen. Sie lebten hier, weil sich die kulturellen Institutionen auf dichtem Raum drängten, in denen man sich eben traf: In den Theatern, im Literarischen Cafe, nicht zu vergessen in den Tempeln der Moderne: den neu entstehenden Filmpalästen und im Haus des Rundfunks. Zwar pulsierte auch an anderen Ecken der Stadt das Leben, so am Potsdamer- und Leipziger Platz. Aber die besten Adressen, die Avantgarde-Treffpunkte und Clubs lagen im Westen. Das ist lange her. In Abstufungen ist es vergleichbar mit den Entwicklungen in Hamburg, Frankfurt, München, Paris, London oder Madrid. Aber Westberlin hatte eine zweite, ureigene Westgeschichte. Als am Ende von Faschismus und Krieg nicht nur das jüdische Bürgertum, sondern bürgerliche Werte und bürgerliches Selbstbewusstsein insgesamt genauso vernichtet waren wie die Städte, Straßenzeilen, Boulevards, Parks und Villen, da begann in West-Berlin eine zweite Phase trotziger Selbstbehauptung. Die umzingelte und dann eingemauerte Stadt, wurde nicht nur von den drei Westalliierten demonstrativ hochgehalten als Schaufenster des Westens, sie hielt sich auch selbst. Trotz des unwiederbringlichen Verlustes von großbürgerlicher Weltläufigkeit und mäzenatischer Noblesse fand sie ein inneres Gespür von dem, was zu verteidigen war: Sie wollte besonders sein, und sie wurde es. In den frühen 60igern waren – jedenfalls auf Zeit - fast alle bedeutenden Schriftsteller deutscher Sprache in Berlin: Uwe Johnson, Hans-Magnus Enzensberger, Ingeborg Bachmann, Christoph Meckel, Günter Grass. Im Schillertheater fanden die Uraufführungen von Samuel Beckett, Peter Weiß, Vaclav Havel statt. Die Freie Universität Berlin war eine attraktive Adresse für aufmüpfige, zunehmend rebellische Geister. Mit der beginnenden Studentenbewegung traf man sich in der "Gegen- Öffentlichkeit" des Republikanischen Clubs, den einmal Peter Brückner, Ulrich K. Preuß, Otto Schily und damals noch Horst Mahler gegründet hatten. Clubs, Kabaretts, Restaurants, wie die Paris-Bar und der Zwiebelfisch, drängten sich ebenso im Zentrum Charlottenburgs, wie allein sechs verschiedene politische Buchhandlungen. Der Verlag Klaus Wagenbach mit seinen roten Bänden behauptete sich, wie verschiedene neugegründete Verlagsprojekte und die Zentren für die ganz andere Musik- und Kabarettkultur: das Reichskabarett (später Grips-Theater) und natürlich der legendäre Steve-Club, der für alle Liedermacher die ersten kleinen Gagen garantierte. Zum Theatertreffen der Berliner Festspiele eingeladen zu sein, war ein absoluter Ritterschlag für jede deutschsprachige Bühne, nicht zu reden von den Jazztagen, die sogar in der Philharmonie stattfanden und natürlich der Berlinale, die im Zoopalast internationales Flair verbreitete. Es war dieses West-Berlin, nach dem ein Jurek Becker, ein Manfred Krug und eine Monika Maron, ja vermutlich auch ein Gregor Gysi und ein Thomas Flierl Sehnsucht hatten, also jene Teile der Jeunesse Dorée aus gutem Hause, die es auch in Ost-Berlin gab. Und nicht einmal die politischen Zentralfiguren der Stadt - immerhin Willy Brandt, Hans Jochen Vogel, Heinrich Albertz, Richard v. Weizsäcker, Egon Bahr - waren auch nur ein klitzekleiner Einwand dagegen, dass sich auch politisch die interessantesten Köpfe für dieses West-Berlin verantwortlich fühlten. II. Harter Schnitt - Ende der sentimental Journey. Dieses alte West-Berlin gibt es nicht mehr. Es ist aber nicht vom Krieg zerstört, nicht von der Globalisierung, nicht von einem diabolischen Masterplan. Es gibt eine eigenartige Krankheit in dieser Stadt, die in einer katastrophalen Schwächung des eigenen Selbstbewusstseins und der fehlenden Ahnung, was sich eigentlich zu verteidigen lohnt, gesucht werden muss. Hier kurz die Fakten: Das Schillertheater, einst Wirkungsstätte großer Intendanten, ist aufgegeben, die Deutsche Oper, einmal von selbstbewussten Bürgern finanziert und in der Nachkriegsphase wieder aufgebaut, hat nach der legendären Ära Götz Friedrichs einen katastrophalen Absturz erlebt und ist heute mit einer unsichtbaren Intendanz und einem ebensolchen Generalmusikdirektor beglückt. Die Schaubühne Peter Steins, einst geradezu ein Mythos der gesamten europäischen Theatertradition, kommt aus den kindlichen Rosenkriegen nicht heraus, spielt keine Rolle in der Stadt. Die Freie Volksbühne Piscators steht elf Monate im Jahr leer. Eine Bank, die sich Deutsche Bank nennt, will die letzten beiden einmal von Max Reinhardt geplanten Bühnen, die den Kurfürstendamm noch zum Boulevard machen, herauswerfen oder gnadenhalber in das zweite Obergeschoß verbannen. Die Kabarettszene hat Termine auf Durchreise. Die Akademie der Künste, lange Zeit ein wunderbar diskursiver Ort im Hansaviertel, irrlichtert jetzt in einem kalten Schaufenster am Pariser Platz, "für Modenschauen bestens geeignet" (Friedrich Dieckmann). Die Straßen um den Kurfürstendamm leeren sich. Die Paris-Bar geht in Insolvenz und im Berlin-Pavillon, der einmal die Weltausstellung und später immerhin noch die KPM-Tradition anbot, thront jetzt ein Burger King. Die alten Cafes des Ku'damms, das Kranzler oder Möhring, sind verschwunden. Auf der Rolltreppe des illustren KaDeWe's bieten sich heute russische Mädchen an. Ist das einfach der Lauf der Dinge? Ist das Globalisierung live? Ist es ein Phänomen des Untergangs der alten europäischen Städte, das nur ankündigt, was europaweit sowieso passieren wird, nämlich der Aufstieg eines vitaleren Ostens zu Ungunsten eines zunehmend melancholisch und destruktiv werdenden Westens, der zwar wohlhabend aber letztendlich nicht mehr kreativ ist? "Ach was", sagen fast gleichlautend Klaus Wagenbach, der Verleger und Klaus Hoffmann, der Chansonnier, "das ist nur das ganz normale Berlin". Es sind gerade die in Berlin Geborenen, die treuesten Kinder der Stadt, die mit dem vergeblichen Kampf um das Schillertheater in nüchterner Trauer die entscheidende Schlacht um den Selbsterhalt des alten Kulturstandortes Westberlin als verloren notieren. Und tatsächlich will es manchem so scheinen, als ob damals diese eigenartige Berliner Krankheit angefangen hätte, die nichts mehr wagt und alles über sich ergehen lässt. III. Und die Stadtpolitik? Sie hat kein Konzept. Sie verweist darauf, dass doch nach allerlei Leerstand ein paar Geschäfte wieder an den Kurfürstendamm zurückkehren. Sie lässt nicht einmal einen Grundalarm spüren, der dem Ausmaß des kulturellen Verlustes auch nur annähernd gewachsen wäre. Der aus Ostberlin stammende Kultursenator zeigt über das Westberliner Desaster keine Trauer, hat aber viele Amtsstunden und Hunderttausende Euros dafür genutzt und nutzen lassen, den maroden Palast der Republik als unverzichtbaren zentralen Ort Berliner Identitäten zu verteidigen. Ansonsten verlieren die Insulaner im Senat ihre Ruhe nicht und hoffen weiterhin unverfroren darauf, dass der Bund im Zweifelsfalle noch die eine oder andere Million rüberschieben wird. Der Bund hat sich engagiert, er zahlt inzwischen mehr für die Kultur in Berlin als der berliner Finanzsenator. Der Bund engagiert sich, wie ein Bund eben nur tun kann, nämlich zentralistisch und repräsentativ: Für die Museumsinsel, für die Opernstiftung, für die Elite-Universität, für die Gedenkstätten, für den Wiederaufbau des Zentrums und seiner eigenen repräsentativen Gebäude. Das verstärkt den Zentralismus der Mitte und hilft den Kiezen wenig. Es ist Sache der Stadt, einen Masterplan für die gesamte Fläche der Kulturlandschaft Berlin zu entwickeln. Kultur ist das letzte wirkliche Wirtschaftsstandbein Berlins. Hotels, Restaurants, Geschäfte, Gaststätten, gute Wohnungen siedeln sich um Kulturinstitutionen an. Wenn sich diese alle auf demselben einzigen Quadratkilometer im Zentrum von Berlin Mitte konzentrieren, stürzen alle anderen Viertel grundsätzlich und unaufhaltsam ab. Wenn in Geschäftsstraßen sich nur noch die Filialisten einmieten, verramschen sie. Es ist also nicht nur eine Frage der kulturellen und der historischen, sondern der wirtschaftlichen Vernunft, die gleichmäßige Entwicklung der ganzen Stadtfläche mit ihren kulturellen Zentren zum zentralen Wahlkampfthema zu machen. IV. Die großen deutschen Firmen verhalten sich in der Regel zum Standort ihrer Hauptstadt Berlin auf eine Weise, die man nur schofelig nennen kann. Jeder Politiker weiß ein Lied davon zu singen, wie mühselig das Antichambrieren bei den Konzernchefs selbst für kleine Beträge ist. Die Deutsche Bank hat sich mit ihren 5 Millionen für die gut globalisierungstauglichen Berliner Philharmoniker (wohlgemerkt: eine Million pro Jahr, auf fünf Jahre begrenzt!) von weiterem Großengagement im Wesentlichen freigekauft. Sie unterstützt zwar eine Messe für zeitgenössische Kunst in London, aber nicht das ArtForum in Berlin. Ihr Immobilienfonds will dem Ku-Damm eine weitere Shopping-Meile hinzufügen, statt sich mit dem Einsatz für Komödie und Theater am Kurfürstendamm zeitlich und ewig Verdienste um die Stadtlandschaft zu erwerben. Und die Bürger, jene so schmerzlich vermissten Citoyens, ohne die eine Stadt nicht leben kann? Es ist ja nicht wahr, dass es solche in Berlin nicht gäbe. Zwar ist Berlin, verglichen mit anderen Städten, weniger wohlhabend. Aber Citoyen zu sein war immer zunächst eine Frage dessen, was man an Bildung, an Weltläufigkeit, an kultureller Neugier, an intellektuellen Netzwerken zur Verfügung hatte. Ein Citoyen ist man nicht per Geburt und nicht wegen eines Bankkontos, man ist es, weil man es sein will. Noch einmal Klaus Wagenbach: "In einer Stadt, für die man sich verantwortlich fühlt, muss man als Kind ins Theater gegangen sein." Nimmt man das mit der Kindheit nicht so ganz genau, sondern zählt die Studentenzeit mit dazu, gäbe es eine ganze Menge an Menschen, die einem dazu einfielen. Sie müssen nur endlich sichtbar werden. V. Für den Verlauf der nächsten Monate ist entscheidend, ob dieser ganze Niedergang West-Berlins politisches Thema wird, oder ob man ihn stoisch auf das Konto des ewigen Auf und Ab sozialen Schicksals verbucht. Es ist Wahlkampf in Berlin und die Notwendigkeiten, an denen die Parteien zu messen sein werden, liegen auf der Hand: Ein Masterplan für den Erhalt der verschiedenen kulturellen Zentren für die gesamte Stadtfläche in Ost und West hat Priorität. Mit den Immobilienbesitzern muss darüber gesprochen werden, dass sie selbst langfristig ihren eigenen Ruin betreiben, wenn sie durch weitere Ramsch- und Filialisten- Verpachtungen den Wert ihrer eigenen Grundstücke vermindern. Der Bahnhof Zoo als letzte zentrale Anlaufstelle West-Berlins ist zu verteidigen. Die beiden Theater am Kurfürstendamm – immerhin die Sprechbühnen mit dem größten Platzangebot in der Stadt und dazu von dem berühmten Oskar Kaufmann gebaut -hätten längst unter Denkmalschutz gestellt werden müssen. Das zu tun ist auch heute noch möglich. Die Berliner Theater insgesamt sollten lernen, dass sie nicht durch drei Insider-Kritiken in den bundesweiten Medien und deren Einfluss auf die Politik gesichert werden, sondern durch Verankerung in ihrem Kiez und ihrem Publikum. Da ist viel zu tun. Die Stadtbürger, die auf Dauer wenig Lust haben werden, sich in dem selben Quadratkilometer mit jedem anderen Kulturinteressierten und jedem anderen Touristen um die raren Plätze zu drängeln, müssen begreifen, daß Einzelhandelsgeschäfte, Theater, kleine Museen, Cafes in dem Quartier, nicht leben können, wenn Geiz weiterhin geil und Schnäppchenmentalität angesagt ist. Die junge internationale Szene, die dem grandiosen Nachwendemythos Berlins gefolgt ist und weltweit dafür sorgt, daß Berlin zur Zeit – noch! – als hippeste Stadt der Welt gilt, wird weiterhin neue Randviertel vor allem im Osten suchen und entdecken, weil es da aufregend zu leben und billig zu wohnen und zu arbeiten ist. Das ist auch gut so. Aber ihre Käufer werden
© 2015 Dr. Antje
Vollmer